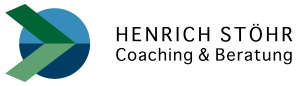[date]
Rivalen statt Kollegen
Zum Change bei Peugeot und Opel
Wie schwierig große Change-Vorhaben wie eine Fusion sind, zeigt aktuell das Beispiel Opel. 2017 hat der französische Peugeot-Citroën-Konzern PSA die deutsche Traditionsmarke 2017 übernommen und fährt seitdem einen harten Spar-, Kosten- und Effizienzdruck. Dass der bei den Opelanern nicht gut ankommt, zu Sorgen, Ängsten und damit Widerstand führt – das war abzusehen und ist regelmäßig Teil der medialen Berichterstattung über den automobilen Zusammenschluss.
Doch jetzt wurde noch eine andere Facette bekannt: Laut einem Bericht der „WirtschaftsWoche“ (https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/autobauer-spannungen-zwischen-psa-betriebsrat-und-opel-arbeitnehmervertretern/21263272.html)gibt es nämlich nicht nur die (erwartbaren) Spannungen zwischen der Opel-Belegschaft und dem PSA-Management, sondern auch zwischen den deutschen Arbeitnehmervertretern und ihren französischen Kollegen – also gewissermaßen von gleich zu gleich. Nicht nur, dass die deutschen Betriebsräte einem Treffen der Gewerkschafter europäischer Standorte von Opel-Vauxhall und PSA fernblieben. Nein, der französische Gewerkschaftssekretär Christian Lafaye hatte auch gleich mal deutlich gemacht, dass die deutschen Beschäftigten keine Solidarität ihrer französischen Kolleginnen und Kollegen zu erwarten haben. „Die französischen Gewerkschaftspartner sind nicht bereit, den französischen Arbeitnehmern einen weiteren Plan zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit aufzubürden“, zitiert die die „WirtschaftsWoche“ den Franzosen, PSA werde als Konzern nicht die Wettbewerbsprobleme deutscher Standorte schultern.
Das Beispiel zeigt, wie komplex die Organisation von Change-Projekten sind: Es reicht eben nicht, einfach nur Spar- und Produktivitätsziele zu verkünden, die Führungskräfte darauf einzuschwören und vielleicht noch eine Informations- oder Kommunikationskampagne zu starten. Vielmehr müssen auch die wirklichen Erfolgstreiber für Veränderungen in den Blockgenommen werden – die allerdings oft im Verborgenen liegen. Zum Beispiel die Frage, inwiefern das neue Unternehmen auf Werte wie Solidarität, Teilen oder Kooperation zwischen allen Beschäftigten bauen kann. Oder, siehe PSA, eben nicht, weil es ganz offensichtlich nicht nur die Widerstände der Opelaner – als den gefühlten Opfern – gibt, sondern auch Verlustängste auf Seiten der französischen „Gewinner“.
Die Erfahrungen in Change-Management-Projekten zeigen immer wieder, dass solche verdeckten Muster und Einstellungen entweder nie oder viel zu spät bewusst werden. Und deshalb auch nicht bearbeitet werden – mit der Folge, dass sich Widerstände nicht auflösen lassen, sondern verschärfen. Wenn die PSA- und Opel-Spitze klug ist, nutzt sie deshalb diesen jetzt bekannt gewordenen Konflikt ihrer beider Beschäftigten-Gruppen, um das Megaprojekt erfolgreich voranzutreiben.